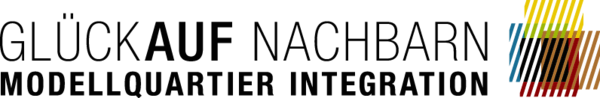Die Wohnung ist der persönliche Lebensmittelpunkt im Quartier, der die Bewohner in ihrem Stadtteil verankert und sie sich dort heimisch fühlen lässt. Dafür ist es entscheidend, dass die Wohnungen im Quartier individuellen Bedürfnissen gerecht werden und multifunktional gestaltet sind. Gleichzeitig müssen sie als Orte des Zusammenlebens funktionieren und in ihrem Umfeld Räume der Begegnung bieten, in denen beiläufig Nachbarschaft entsteht. Dafür sollten gemeinschaftlich genutzte Räume in Wohnungen oder im Wohnumfeld vorhanden und gut zugänglich sein. Bei Veränderungen im Wohnungsbestand ist darauf zu achten, dass das sozioökonomische Gefüge nicht zerstört wird. Ziel ist es, Quartiere zu Orten bunter Durchmischung zu entwickeln, mit denen sich die Bewohner identifizieren.
Bedarfsgerechte Wohnungen und Gebäude mit zielgruppengerechten Grundrissen und Gemeinschaftsflächen
Um Teilhabe für alle Menschen im Quartier zu ermöglichen, ist es entscheidend, dass Wohnungen so vielfältig sind wie die Bedürfnisse ihrer Bewohner und gleichzeitig Interaktion zwischen ihnen fördern. Dies gelingt, indem bei neu gebauten oder grundlegend sanierten Wohnungen mittels unterschiedlicher Grundrisse verschiedene Zielgruppen angesprochen und prioritär Wohnformen mit Gemeinschaftsflächen umgesetzt werden. Diese sind auch deswegen von besonderer Bedeutung, da sie zusammen mit Barrierefreiheit das Grundgerüst für ein selbstbestimmtes Leben besonders für die wachsende Gruppe der älteren Menschen oder Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen im Quartier bilden.
Sie sind dabei vielfältig nutzbar, z. B. als gemeinsame Wohnküche oder Wohnzimmer. Um diese Wohnformen auch weniger einkommensstarken Bevölkerungsgruppen zugänglich zu machen, sind kostenoptimierte Bauweisen im Neubau ebenso bedeutsam wie Maßnahmen, die im Bestand umgesetzt werden können. Zudem ist gegebenenfalls eine Finanzierung mit Landesfördermitteln zu prüfen. Folgende Umsetzungsideen zeigen, mit welchen Wohnformen individuelle Bedürfnisse berücksichtigt werden können und Gemeinschaft gefördert werden kann.
Schaffung halböffentlicher und öffentlicher Bereiche im Wohnumfeld zur Sicherung gemeinschaftlicher Funktionen für das Quartier
Um Kommunikation zwischen den Bewohnern im Wohnumfeld zu fördern, braucht es Orte der Begegnung auch in unmittelbarer Nähe zum Haus. Entscheidend dabei ist, dass das Leben der Bewohner füreinander sichtbarer wird. Das Wohnumfeld ist daher so zu gestalten, dass Bewohner und Anwohner dazu animiert werden, möglichst oft die kleinräumigen Schnittstellen zwischen Gebäuden und Freiraum zu nutzen. Dies gelingt durch folgende beispielhafte Umsetzungsideen:
Hybride, multifunktionale Orte des Wohnens, Arbeitens und der Gemeinschaft
Der Trend zu einer zunehmenden Vermischung von Wohnen, Leben und Arbeiten wird sich laut RAG-Stiftung-Zukunftsstudie in den nächsten Jahren weiter verfestigen. Bei Neubau, Modernisierung oder Neubelegung von Wohngebäuden sollte daher das Wohnen konsequent in Kombination mit anderen Funktionen betrachtet werden. Zentral dafür ist die möglichst offene und lebendige Ausgestaltung der Erdgeschosse in Wohngebäuden. Indem Erdgeschosse nicht mit privaten Wohnungen, sondern mit großzügig verglasten Räumen für Arbeit, Nahversorgung oder Gemeinschaft belegt werden, tragen sie dazu bei, das Leben im Quartier einladend und sichtbar zu machen. Außerdem geben sie den Bewohnern die Möglichkeit, im direkten Umfeld einer Erwerbstätigkeit, ehrenamtlichem Engagement o. Ä. nachzugehen. Erdgeschosse können beispielsweise belegt werden mit:
Siehe auch: These 53 der RAG-Stiftung-Zukunftsstudie

Bei Quartieren mit hohem Anteil an Mietwohnungen: Bestandserhalt/ Modernisierung vor Neubau – damit Anerkennung der Bestandsmieter als wichtige identitätsstiftende Gruppe
Bestandsmieter sind zentrale Akteure bei der Gestaltung und Prägung der Identität in einem Quartier. Bei der Sanierung und Modernisierung von Bestandsgebäuden ist daher darauf zu achten, dass diese mit Augenmaß durchgeführt werden.
Behutsame Nachverdichtung zur Verbreiterung eines bisher zu homogenen Wohnungsgemenges
Indem durch einzelne Neubauten ein Quartier behutsam nachverdichtet und ein homogenes Wohnungsgemenge ergänzt wird, kann die Zusammensetzung der Bewohnerschaft verbreitert werden.
Direkt zu: Übergeordnete Hinweise // Wohnen + // Öffentlicher Raum/Freiraum // Nahversorgung/Infrastruktur // Mobilität // Lokale Ökonomie // Bildung // Managementansätze