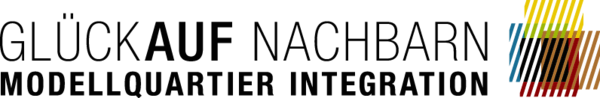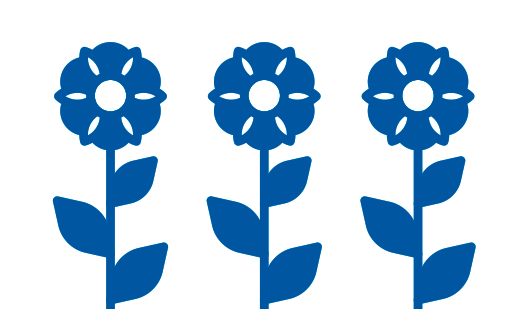Als Ort des alltäglichen Lebens steht der öffentliche Raum per Definition allen Bevölkerungsgruppen im Quartier offen. Gerade hier müssen für eine gelungene Integration Austausch und Begegnung gefördert werden. Dies kann durch attraktive öffentliche Plätze geschehen, die für unterschiedliche Zwecke und Anliegen frei nutzbar sind. Genauso können aber auch gezielt gestaltete Angebote zu Anziehungspunkten im öffentlichen Raum werden und die Bewohner des Quartiers zusammenbringen. Gleichzeitig lassen sich auch bisher nicht oder wenig genutzte Frei- und Leerräume wie Innenhöfe oder Grünflächen zwischen einzelnen Wohnblocks für eine (halb-)öffentliche Nutzung zugänglich machen, indem ihre kommunikativen Potenziale gestärkt werden.
Multifunktionale Nutzung öffentlicher Räume
Öffentliche konsumfreie Plätze dienen als geteilte Räume – auch "Third Places" genannt – allen Menschen im Quartier als Orte des Austauschs. Entscheidend dafür, dass sie von möglichst vielen Menschen genutzt werden, ist, dass einige von ihnen explizit deutungsoffen und damit multifunktional sind. Beispielsweise spricht eine grüne Wiese, die für Ballspiele, Grillpartys oder Picknicks etc. offen ist, deutlich mehr Menschen an als ein befestigter Fußballplatz mit fixierten Torstangen. Um Bewohner zum Verweilen anzuregen, soll zudem die bestehende Infrastruktur dieser Räume aufgewertet werden. Temporär ist auch die exklusive Nutzung dieser Plätze, z. B. für Stadtteilfeste, möglich und sogar gewollt. Folgende Umsetzungsideen sind denkbar:

Gestaltung öffentlicher Räume als attraktive, zugängliche Aufenthaltsorte mit differenzierten Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen
Neben bewusst deutungsoffenen Räumen braucht es auch differenzierte Angebote für festgelegte Aktivitäten und Erlebnisse im öffentlichen Raum. Diese bringen Bewohner mit ähnlichen Interessen zusammen und fördern die Interaktion im Quartier. Bei der Art der Angebote sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt; die Angebote können sehr einfach bis sehr aufwändig sein. Generell ist wichtig, dass die Aufenthaltsorte, an denen die Angebote platziert sind, attraktiv gestaltet und für ganz unterschiedliche Bewohner zugänglich und in ihren Alltag integrierbar sind. Denkbare Umsetzungsideen sind:
Aufwertung von Innenhöfen durch unterschiedliche themenbezogene Nutzungsschwerpunkte
Innenhöfe eignen sich aufgrund ihrer Lage sehr gut dafür, einem Teil des täglichen Lebens mehr Sichtbarkeit zu verleihen. Wenn sie über einen spezifischen Themenfokus und Charakter verfügen, ziehen sie unweigerlich Bewohner des Quartiers an, die sich für dieses Thema interessieren. So etablieren sie sich als kleinräumige Treffpunkte für gemeinsame Aktivitäten im Quartier, die für alle Bewohner offen sind. Entscheidend für die gelungene Etablierung von themenbezogenen Innenhöfen ist die Belegung der Erdgeschosse, von denen Impulse für Aktivitäten im Innenhof ausgehen. Beispiele sind:
Aufwertung und Anbindung von kleinteiligen Freiräumen an ein grünes Netzwerk
Das grüne Netz eines Quartiers übernimmt wichtige soziale und ökologische Funktionen und wird auch laut RAG-Stiftung-Zukunftsstudie künftig eine wichtige Rolle bei der Bewertung von urbanen Räumen spielen. Daher lohnt es sich, kleinteilige Freiräume landschaftlich abwechslungsreich zu gestalten und an ein bestehendes – auch überregionales – grünes Netzwerk anzubinden, in dem die Bewohner sich gerne aufhalten. Dadurch können Bewohner vorher brachliegende oder kaum beachtete Flächen wieder für sich entdecken und diese auch nutzen. Beispielhafte Umsetzungsideen, die darauf einzahlen, sind:
- Qualifizierung straßenbegleitender Grünflächen durch das Anlegen von Blumenbeeten etc.
- Ausbau von Grünverbindungen, indem fehlende Verbindungen zu bestehenden Grüntrassen neu angelegt werden; dadurch können beispielsweise vorher räumlich abgetrennte Industriehalden nach ihrer Öffnung für die Bevölkerung erschlossen werden und sich so ins Quartier integrieren
- Inszenierung aktiver oder stillgelegter Infrastruktur im öffentlichen Raum, wie z. B. Industriedenkmäler

Direkt zu: Übergeordnete Hinweise // Wohnen + // Öffentlicher Raum/Freiraum // Nahversorgung/Infrastruktur // Mobilität // Lokale Ökonomie // Bildung // Managementansätze